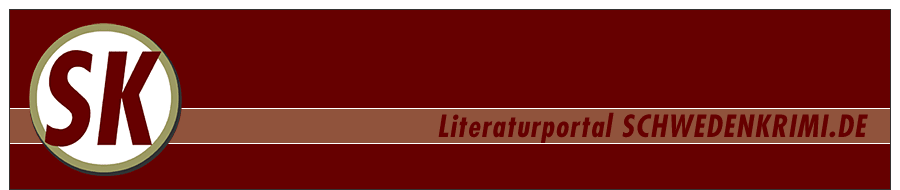Hamburg, Dezember 2009
Herr Milberg, der neueste Wallander-Roman der Der Feind im Schatten ist die letzte Begegnung mit dem eigenwilligen Kommissar aus Schweden. Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Kurt Wallander?
Ja, das ist schon ziemlich lange her. Es war gegen Anfang der 90er Jahre, dass ich zum ersten Mal einen Krimi mit Kurt Wallander in der Hand hielt. Ich habe ihn im Urlaub am Swimmingpool meiner Frau stibitzt, fing an zu lesen und konnte gar nicht mehr aufhören. Mir blieb die Klappe offen stehen, wie fleißig, wie spannend und wie anschaulich dieser schwedische Autor schreiben kann. Hundert falsche Fährten legt er aus und zwei führen dann schließlich weiter und entpuppen sich als richtig. Er schafft es, diesen Bienenfleiß zu schildern, den die Polizei an den Tag legen muss. Er schreibt so nah am Polizeialltag und doch so spannend. Und dann natürlich diese Figur: der übergewichtige, etwas kurzatmige, mürrische, einsame Kurt Wallander, der nichts mit dem herkömmlichen Helden gemein hat, aber der wir sofort alle sind.
Wie meinen Sie das?
All das, was Kurt Wallander beschreibt, kennt man, er ist keine stilisierte Figur. Mankell stellt wie alle großen Künstler dieses Wunder des Sich-Wiedererkennens her: Oh, das bin ja ich! So wache ich auf, so gehe ich ins Bett, so stehe ich am Meer, so schaue ich aufs Wasser, so misslingen mir Dialoge und Gespräche, so schütte ich mir einen Whisky ein, so höre ich Musik, so liebe ich ohne viele Worte, so verstehe ich mich mit Kollegen oder werde ich ungeduldig und bin jähzornig. Und so hat Mankell es geschafft, dass Kurt Kult geworden ist, obwohl und gerade weil Kurt Wallander uns so nah ist.
Aber das Wiedererkennen hat doch seine Grenzen. Schließlich sind nur die Wenigsten von uns Kommissare, was den Reiz des Krimis ausmacht …
Ja, der Kriminalroman mit seinem Auftrag an die ermittelnden Behörden gibt uns, den Lesern, einen Vorwand durch Welten zu wandern, die ein normaler Bürger gar nicht erlebt. Die Gesellschaft ist unübersichtlich geworden. Es gibt viele Parallelwelten. Das Wort kann man mögen oder nicht, aber es beschreibt in einem Begriff, dass wir die Übersicht nicht mehr haben, auch in unserem eigenen Leben nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht viel von dem, was um mich herum in München stattfindet. Ich habe da meine Familie und ich habe da meine Gänge, den Weg zum Flughafen und so weiter. Aber ich bin nicht viel in den Restaurants, im Nachtleben, in Bars, in Puffs, in den christlichen Gemeinden, in der Kirche, nicht im Krankenhaus, nicht in der Kaserne, nicht beim Militär, nicht in den Badeanstalten, nicht in den Klöstern – so könnte ich ewig fortfahren, Welten aufzuzählen, in denen ich mich nicht auskenne.
 |
| Axel Milberg, Copyright Marion von der Mehden |
Und als Ermittelnder musst Du ganz tief bohren, in diese Welten vordringen, jeden Stein umdrehen. Und das macht Wallander. Und dabei ist er kurzatmig, hat Zucker und trinkt gerne Whisky, vernachlässigt seine einzige Tochter, ist grimmig mit seinen Kollegen. Er hat also all die Defizite, die wir fürchten, auch zu haben, wenn wir nicht aufpassen, gegen die wir ankämpfen, weil uns die Kraft fehlt, das Temperament, das Herz, die Empathie, die Zeit.
So viel zum Kommissar Wallander. Nun zum Sprecher Axel Milberg – wie würden Sie Ihre Art des Lesens beschreiben?
Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen soll, würde ich sagen, dass ich ein intuitiver Sprecher bin. Aber die Intuition ersetzt nicht die Vorbereitung, sondern kommt hinzu. Für mich ist das Lesen ein physisches Erlebnis. Das heißt, ich sehe, was ich lese. Ich sehe einen Film. Diesen Film beschreibe ich im Grunde genommen den Hörern. Nehmen wir zum Beispiel den Anfang von Mankells Roman
Der Chinese. Der ist aufgebaut wie ein Film. Sie kommen aus der Totale, zoomen aus der Totale über Norwegen über die Grenze nach Schweden, einen Fluss überquerend, sozusagen wie eine Helikopterfahrt über die verschneite Landschaft folgen Sie einem Wolf über verschiedene Orte bis dorthin, wo der Wolf stehenbleibt und anfängt, den abgetrennten Fuß in einem Schuh, den Unterschenkel, das Bein eines Menschen anzunagen. Da zoomt dann die Kamera langsam näher, aus der Totale in die Halbtotale, in die Nah- bis in die Großaufnahme. Und dann ist Schnitt. Und dann sind wir bei dem Mann, der nur noch dieses eine Dorf besuchen will, um Fotos zu machen von den verschneiten Häusern, aus deren Schornsteinen Rauch aufsteigt. Und so haben Sie im Grunde genommen einen filmischen Aufbau.
Was bedeutet für Sie beim Lesen im Studio die Regie?
Meine Regisseurin Caroline Neven Du Mont, mit der ich bei meinen Aufnahmen in München meistens zusammenarbeite, ist für mich meine stellvertretende Zuhörerin. Wenn sie sich langweilt, wird sich auch der Zuhörer langweilen. Außerdem neige ich dazu, zu schnell zu lesen – und dann sagt sie mir »langsamer«. Sie hat an der Lesung eine ungeheure Leistung, selbst wenn sie wenig sagt. Ihre Leistung ist es, dass sie immer sehr wach zuhört, um zu kontrollieren, wie es später dem Zuhörer gehen wird.
Was macht für Sie den besonderen Reiz der Studioarbeit aus?
Das Herrliche bei Studioaufnahmen ist, dass das Optische wegfällt. Ich könnte also im Pyjama dastehen, mit Duschhaube, und einem Popel in der Nase – das wäre völlig egal. Es gibt zwischen dem Text und meiner Stimme nur meine Fantasie und die Art zu denken. Ich erschaffe sozusagen eine Welt durch die Stimme. Ich mache Unsichtbares sichtbar. Das sind für mich Sternstunden des Berufs. Also ich mache das nicht, um davon zu leben. Beim Schaffen einer Welt, da stört so wenig. Da muss es keine Beleuchter geben, keine Maske und Wohnwagen und Catering. Es ist die Konzentration auf etwas ganz Wesentliches, das den Schauspieler ja ausmacht – in der Flut der Bilder, in der wir stehen, von Youtube und dem Fernsehen und dem Kino und Facebook und so weiter – das Auge schließt sich, ruht aus, die Ohren öffnen sich und Du geht im Kopf spazieren, angeregt durch das, was Du hörst. Als ich Henning Mankell einmal erzählte, dass in Berlin im Planetarium vier-, fünf-, sechshundert Menschen in Liegestühlen unter dem gestirnten Himmel liegen und Hörspielen lauschen, war er ganz erstaunt und freute sich.
Sie kennen Henning Mankell persönlich. Wie würden Sie den Menschen Mankell beschreiben?
Er ist ein Mensch, bei dem man verblüfft darüber sein muss, wie viele unterschiedliche Leben er zu haben scheint. Er ist hier und da und dort. Er unterstützt Christoph Schlingensief und ist dann wieder in Afrika und hat sein Theater und inszeniert dort und hat einen Verlag für Dichtung aus Afrika und der Dritten Welt gegründet und eine Produktionsfirma, die er aber inzwischen wieder verkauft hat. Er kümmert sich um die Realisierung seiner Bücher, auf die er einen letzten Blick hat, genau wie auf die Filme. Und er schreibt – und wir wissen ja, das Schreiben ist eine einsame Tätigkeit, bei der man keine Störungen vertragen kann. Er hat vier Kinder. Und er liebt es, Geschichten zu hören, erzählt zu bekommen. Wobei er ungeduldig ist, das spürt man. Er hat keine Zeit für Smalltalk, für Gelaber, für Meinungen und so weiter. Aber er liebt es, Geschichten zu erzählen und Geschichten erzählt zu bekommen, egal von wem, nicht intellektuelles Gewäsch, sondern Geschichten, die das Leben beschreiben in den verschiedensten Kontinenten und Lebensformen.
Was zeichnet einen »typischen« Mankell aus?
Ich denke, seine Einstellung, dass jedem Verbrechen ein anderes Verbrechen vorausgegangen ist. Das ist, so scheint mir, eine skandinavische Tradition. Dieses Gleichgewicht des Verbrechens ist ein großes Thema auch in den privaten und politischen Ansichten Mankells. Jedes Verbrechen hat einen Grund in einer sozialen Ungerechtigkeit. Ich bin da anderer Meinung als er, ich persönlich. Ich glaube, es gibt auch das Böse im Menschen – leider, wo wir uns mit der Begründung schwer tun würden. Zwei können das Gleiche erleben und der eine wird ein Heiliger und der andere wird Adolf Hitler. Man kann es eben nicht immer erklären, es wäre schön, wenn es so wäre, aber das sieht Mankell eben so. Und in großen Teilen hat er damit sicherlich Recht. Ein großes Thema für ihn sind die Verbrechen der so genannten Ersten Welt an der so genannten Dritten Welt, deren Folgen oft mit Verspätung eintreten. Im
Chinesen ereilt die Nachfahren eines Mannes, der sich 140 Jahre zuvor als sadistischer Aufseher beim Eisenbahnbau in Amerika an den dortigen chinesischen Zwangsarbeitern vergriffen hat, ein grausames Ende. 140 Jahre nach der ursprünglichen Tat. Also das ist Mankell in Reinkultur sozusagen. Der reine Mankell in seiner politischen Überzeugung.
Hat sich der Zugang zu Mankells Werken durch die persönliche Bekanntschaft mit ihm verändert?
Nein. Nein. Nein, das möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass diese Texte wie aus dem Himmel kommen. Das geht mir übrigens mit allen Künstlern so, Musikern oder Schauspielern oder Schriftstellern. Eigentlich möchte ich sie, gerade wenn ich sie sehr verehre, gar nicht unbedingt persönlich kennenlernen – also Mankell ist da für mich eine Ausnahme. Ich will gar nicht so viel verstehen, weil ich lieber meinen eigenen Zugang dazu baue. Oder das Staunende nicht verlieren möchte.
© 2010 Der Hörverlag München Der Hörverlag GmbH • Lindwurmstraße 88 • D-80337 München